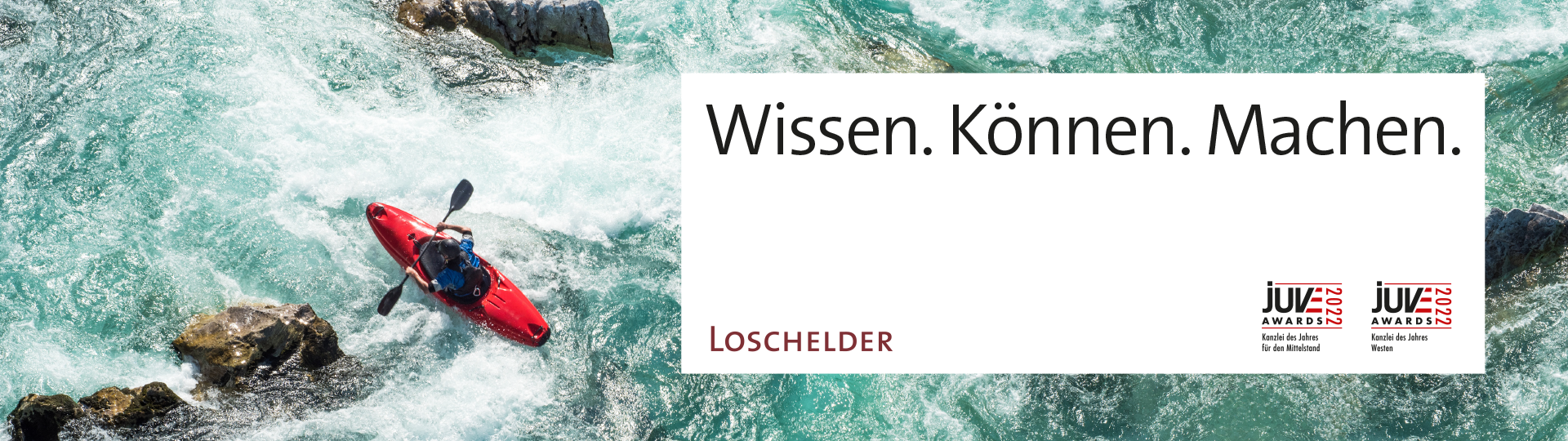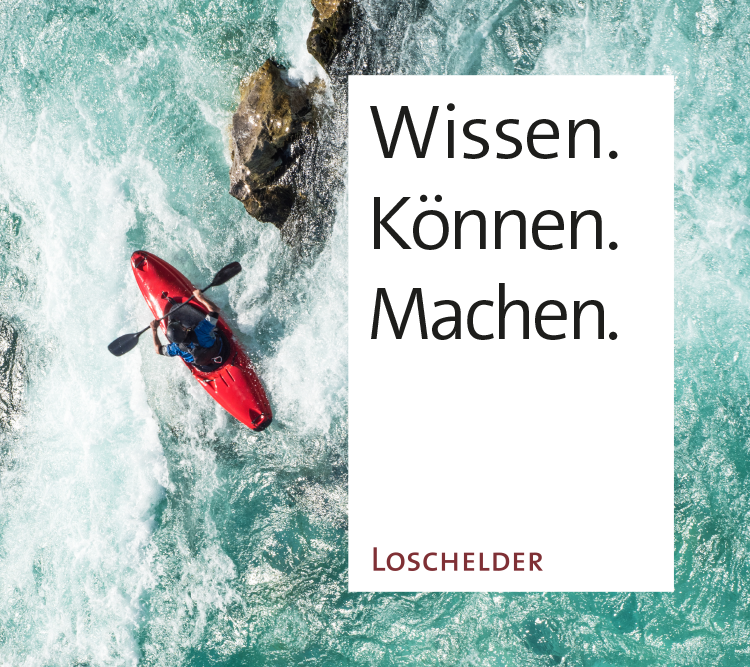Steuerliche Gestaltungsoptionen für erneuerbare Energien
Während der Podcastaufzeichnung: Rolf G. Krauß (links), Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Kanzlei Kucera, spricht mit IZ-Journalistin Monika Hillemacher über Immobilien, Photovoltaik und Steuerstrategien. Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Laura Kolb
Steuerliche Gestaltungsoptionen für erneuerbare Energien

Während der Podcastaufzeichnung: Rolf G. Krauß (links), Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Kanzlei Kucera, spricht mit IZ-Journalistin Monika Hillemacher über Immobilien, Photovoltaik und Steuerstrategien. Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Laura Kolb
Europa soll nach dem Willen der EU bis 2050 klimaneutral werden. Damit das gelingt, muss der Energieverbrauch im Bestand drastisch sinken, parallel der Anteil erneuerbarer Energie deutlich steigen. In Deutschland hat die Branche an der Transformation zu knabbern. Auch aufgrund regulatorischer und steuerlicher Unsicherheiten. Ein Gespräch mit Rolf G. Krauß, Steuerfachmann der Kanzlei Kucera, über Immobilien, Photovoltaik, Steuergestaltung und gutes Klima.
Interview: Monika Hillmacher
Immobilien Zeitung (IZ): Der Gesetzgeber hat Immobilienbesitzern 2024 einige Änderungen zum Besseren beschert. Dank Solarpaket I ist die Montage von Balkonkraftwerken unbürokratischer geworden. Größere Flächen wie Garagen- und Fabrikdächer können einfacher für PV-Anlagen genutzt werden. Doch das reicht für die Energiewende längst nicht aus. Das nach dem Aus der Ampel-Koalition auf der Kippe stehende Zukunftsfinanzierungsgesetz II, kurz ZuFinG II, sollte helfen, mehr Schwung und Strom aus Sonne in die Leitungen bringen.
Rolf G. Krauß: In Ihrer Aufzählung fehlt noch der Mieterstrom. Da gab es Nachbesserungsbedarf, den der Gesetzgeber mit der im Solarpaket I (Überblick über das Solarpaket I veröffentlicht vom BMWK) eingeführten gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung in weiten Teilen erfüllt hat. Die Erleichterung für Eigentümer besteht unter anderem darin, dass sie – anders als beim Mieterstrom – keine Vollversorgung mehr sicherstellen müssen. Damit entfällt die Pflicht, in Zeiten, in denen die PV-Anlage keinen oder zu wenig Strom liefert, dazukaufen zu müssen.
IZ: Es fällt auf, dass bei den Bemühungen der Politik die Solarenergie stark im Vordergrund steht oder stand.
Krauß: Ja, Photovoltaik wird begriffen als wichtiger Baustein in der Energiewende. Der noch amtierende Gesetzgeber liebt Photovoltaik. Er wollte sie gerne fördern. Das Steuerrecht stellt der Förderung an der ein oder anderen Stelle jedoch Hürden in den Weg. Deswegen sind die Schwierigkeiten des Steuerrechts gegenüber dem Förderungswillen des Gesetzgebers so interessant und wichtig für die Praxis.
IZ: Und worin besteht Ihrer Meinung nach die Hauptaufgabe eines Steuerrechtlers in Bezug auf die Energiewende?
Krauß: Da kann ich nur für mich sprechen. Ich sehe meine Aufgabe darin, Mandanten so zu beraten, dass die PV-Anlage für sie passt und dass diese auch in die existierenden Steuerstrukturen hineinpasst.
IZ: Manche Immobilienbesitzer stehen der energetischen Transformation sehr abwartend gegenüber. Sie tun wenig bis nichts und verweisen auf Kosten und Unklarheiten. Was sich gerade bestätigt.
Krauß: Ein Immobilienbesitzer wird trotzdem nicht drum herumkommen, sich mit den Erneuerbaren zu befassen, weil er zunehmend damit konfrontiert wird. Das liegt schon an der steigenden Solarpflicht, also der Pflicht, erneuerbare Energie auf dem Dach zu produzieren und zukünftig Stromtankstellen an Gebäuden vorzuhalten. Neben der EU installieren auch die Bundesländer und Kommunen solche Vorschriften. Zusätzlich führen ESG-Problematiken, der Wunsch, künftig grüne Gebäude zu haben, um günstige Finanzierungen zu bekommen, zu einem gewissen Druck auf Immobilienbesitzer. Leute, die ehemals nur Immobilien verwaltet haben, können das Thema einfach nicht mehr außer Acht lassen. Erneuerbare Energien gehören heute zur Immobilie wie früher die Parkplatzbewirtschaftung. Man begreift Photovoltaik inzwischen als Bestandteil der Immobilie. Deshalb ist die Frage „Wie halten Sie es mit der PV-Anlage?“ Standard in der Beratung.
IZ: Schauen wir auf die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Sie zielt auf Wohn- wie Gewerbeimmobilien. Wie gehen Eigentümer sinnvoll mit dem Modell um?
Krauß: Zuerst sollten sie sich die grundsätzlichen Rahmenbedingungen anschauen. Verkaufe ich den Strom an meine Mieter? Dann schließe ich einen Vertrag mit ihnen. Betreibe ich die Anlage selbst oder suche ich mir einen Betreiber? Das sind Dinge, die zuerst zu klären sind und die auch die ersten Schritte in der Beratung darstellen. Denn das Steuerrecht hängt sich an die Strukturen an, die man aufsetzt. Insgesamt, denke ich, entwickelt die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, die auch bei Nicht-Wohngebäuden angewandt werden kann, das Konstrukt Mieterstrom fort. Meiner Meinung nach ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ein weiteres Element, EEG-Strom auf der Immobilie sinnvoll zu verwerten.
IZ: Und worauf ist dabei steuerlich zu achten?
Krauß: Dafür Sorge zu tragen, dass das Modell der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung der steuerlichen Struktur einer Vermögensverwaltung oder der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung bei Kapitalgesellschaften nicht ins Gehege kommt.
IZ: Wo heißt es denn für Immobilienbesitzer aufzupassen?
Krauß: Das kommt darauf an, in welcher Immobilienkategorie Sie unterwegs sind. Vermieten Sie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser und betreiben steuerlich gesehen Vermögensverwaltung, müssen Sie es schaffen, dass Stromproduktion und -verkauf Sie nicht in die Gewerblichkeit ziehen.
IZ: Sonst wäre Gewerbesteuer zu bezahlen, was es eigentlich zu vermeiden gilt.
Krauß: Genau. Weil die Stromproduktion sowie der Verkauf originär eine Gewerbetätigkeit sind. EON und EnBW sind ja auch Gewerbebetriebe, keine Vermögensverwaltung. Bei Wohnungsverwaltungsgesellschaften gibt es, um Gewerbesteuer zu vermeiden, die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung. Sie sind damit von der Gewerbesteuer freigestellt. Da muss man aufpassen, dass die Stromproduktion einem dieses Privileg nicht kaputtmacht. Bei offenen Fonds kommt hinzu, dass eigentlich nur Immobilienrisiken darin liegen dürfen. Eine Photovoltaikanlage ist keine Immobilie. Sie vermittelt Risiken, zum Beispiel explodierende Wechselrichter, die von Haus aus nicht in einen solchen Fonds hineingehören. Da ist das Thema, ob der Fonds überhaupt PV-Anlagen halten darf und wie das Steuerrecht auf eine solche aktive unternehmerische Bewirtschaftung (AUB) reagiert. Da hatte die Ampel-Koalition Änderungen vorbereitet.
IZ: Wie entkommen Immobilienbesitzer denn der Steuerfalle?
Krauß: Bei der Vermögensverwaltung wäre eine Lösung, Besitz und Betrieb der PV-Anlage zu trennen. Der Immobilieneigentümer besitzt das Gebäude, die Steine, das Dach und obendrauf die Anlage. Die verpachtet er an einen Betreiber. Der verkauft den Strom an die Mieter. Vielleicht sogar als Incentive. Das heißt, Mieter werden damit gelockt, dass sie ihren eigenen Strom vom Dach bekommen, eventuell etwas billiger als vom herkömmlichen Versorger, oder als Gemeinstrom, was die Nebenkosten senkt. Das wäre eine Option, die eine echte Abgrenzung von Besitz und Betrieb gewährleistet und so sicherstellt, dass keine gewerbesteuerliche Sache überschwappt. Ähnliches kennt die Immobilienbranche aus der Vermietung von Betriebseinrichtungen. Nur: Der Eigentümer muss für die PV-Anlage eine Betreibergesellschaft finden.
IZ: Die kann ich doch selbst gründen.
Krauß: Ach, dann muss ich administrieren, Steuererklärungen abgeben, das bedeutet Aufwand. Für größere Immobilieneigentümer ist das sicherlich machbar, für kleine eher schwierig. Außer einer Betreibergesellschaft gibt es im Rahmen der Vermögensverwaltung keine wirklich sichere Lösung, um nicht in die Gewerbesteuer zu rutschen.
IZ: Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Kapitalgesellschaften werfen.
Krauß: Für sie hat sich der Gesetzgeber ausgedacht, dass die Produktion von EEG-Strom und dessen Verkauf an Mieter unproblematisch sein soll für die Gewerbesteuerbefreiung, wenn die Strom-Einnahmen nicht mehr als 20% pro Jahr ausmachen. Diese Lösung ist über das Solarpaket I im Gewerbesteuergesetz implementiert worden. Ich bin kein großer Freund davon.
IZ: Warum nicht?
Krauß: Eine Prozentregelung leuchtet mir nicht ein. Entweder der Gesetzgeber will die Befreiung oder nicht. Die jetzige Lösung ist weder Fisch noch Fleisch.
IZ: Anscheinend hatte die rot-gelb-grüne Bundesregierung das Dilemma erkannt. Sie wollte über das geplante Zukunftsfinanzierungsgesetz II Lockerungen für Spezialfonds einführen. Was war denn geplant?
Krauß: Im Entwurf zum Gesetz aus dem August steht drin, dass die Solarstromproduktion für offene Fonds generell als unschädlich angesehen werden soll. Eine 20%-Grenze sollte es nicht mehr geben. Voraussetzung wäre, dass die Einnahmen im Zusammenhang mit Vermietung und Verpachtung stehen.
IZ: Das heißt, ein Immobilienfonds, der nur Strom produziert und/oder verkauft, wäre nicht gegangen.
Krauß: Nein, Kontext zur Immobilie hätte sein müssen. Interessant ist der Flickenteppich, der entstanden ist, weil der Gesetzgeber in den drei verschiedenen Steuersystemen mal hier was macht und mal hier nichts macht bzw. gemacht hat.
IZ: Was genau meinen Sie damit?
Krauß: Einmal die Vermögensverwaltung. Da haben wir das Thema der Gewerblichkeit, wo die Tätigkeit weiterhin das Problem bleibt. Dann die 20%-Grenze bei der erweiterten Kürzung, wo nichts passiert ist, die hinderliche Grenze mithin weiter existiert. Und schließlich bei den Fonds die aktive unternehmerische Bewirtschaftung, wo die 20%-Grenze im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes fallen sollte. So betrachtet, stünden die Fonds im Fokus mehrerer Erleichterungen. Die werden aber, so wie es aussieht, vorerst nicht realisiert.
IZ: Die politische Situation verhindert also die Umsetzung. Wie steht es mit dem Fiskus?
Krauß: Ein Kollege von mir hat mal gesagt: Das Finanzamt ist nicht dafür da, einem das Leben zu erleichtern. Im Ernst: Die Finanzbehörden stecken im Zwiespalt. Einerseits ist die EEG-Förderung politisch gewollt – oder sollte ich besser sagen, war? Andererseits möchte keiner, dass Gewerbesteuer ausbleibt. Die Finanzbehörden sind deshalb etwas zurückhaltend. Das sieht man auch an gesetzgeberischen Stellen.
IZ: Ist das der Grund, warum den Institutionellen die wahre Begeisterung für die Energiewende fehlt?
Krauß: Es fördert jedenfalls nicht die Verbreitung erneuerbarer Energien. Planungssicherheit ist ein ganz wichtiger Aspekt, und Unklarheiten bremsen immer. Deshalb auch die Versuche der Politik, erst mit dem Wachstumschancengesetz und, als das nicht geklappt hat, mit dem ZuFinG II Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch geradezuziehen. Das ist für mich überfällig. Wobei in beiden Gesetzesbegründungen steht, es seien Klarstellungen. Daraus folgert ein Jurist rechtsmethodisch, dass das bisher alles schon erlaubt ist. Auch, wenn es nicht ausdrücklich im Gesetz steht.
IZ: Die Branche könnte also, wenn sie wollte? Woraus schließen Sie das?
Krauß: Der Gesetzgeber sagt in den Begründungen, was er regelt, sei klarstellend. Das heißt, es ist nicht neu, sondern schon jetzt aus Gesetzen erkennbar, wenn man genau hinguckt. Wer dies ernst nimmt, der kann das, was vorgesehen war, zum größten Teil bereits heute umsetzen. Was gut ist, weil niemand weiß, ob das ZufinG II überhaupt kommt. Noch-Bundeskanzler Scholz hat es wohl nicht auf seiner Shortlist.
IZ: Spezialfonds hängen wegen der politischen Turbulenzen in Berlin zwischen Baum und Borke. Welche Lösungsoptionen würde Ihre Klarstellungsinterpretation eröffnen?
Krauß: Man kann sich zum Beispiel für ein Trennungsmodell entscheiden: Eine Betreibergesellschaft dazwischenstellen oder drunterhängen. Nach dem Investmentsteuergesetz kann ich so auch AUB-Themen machen und den Betreiber in den Fonds holen, wenn ich das als regulatorisch zulässig erachte. Das ist meiner Meinung der Fall. Oder ein Dritter übernimmt das Betreiben. Eventuell mit einer Regelung, die es später ermöglicht, den Betreiber in den Fonds zu nehmen.
IZ: Was bedeutet Klarstellung denn in Bezug auf die für offene Fonds so zentrale Frage zu Besitz und Betrieb von PV-Anlagen?
Krauß: Da geht es, wieder über das ZuFinG II, um das Kapitalanlagegesetzbuch, § 231. Also was darf ein Immobilienspezialfonds halten, was macht ihn zum Immobilienfonds? In der Praxis taucht immer wieder die Frage auf, ob offene Fonds PV-Anlagen besitzen dürfen oder nicht. Klarstellend hieße, ein Immobilienfonds bleibt ein Immobilienfonds, auch wenn er auf dem Dach eine Photovoltaikanlage hat. Außerdem könnte er die Anlage betreiben und den Strom an die Mieter verkaufen. Ob für Wohnen und Gewerbe macht keinen Unterschied. Regulatorisch ist das eine Klarstellung. Was nicht bedeutet, das dies aus steuerlicher Sicht auch empfehlenswert wäre.
IZ: Wenn Sie in die Zukunft gucken: Was würden Sie sich für die Immobilienbranche und die Förderung der Energiewende wünschen?
Krauß: Bisher fehlt ein schlüssiges Konzept. Vielleicht liegt es auch daran, dass historisch alles nacheinander gewachsen ist. Das derzeitige System erscheint nicht unbedingt geschlossen, sage ich mal freundlich. Faktisch führt das zu Abgrenzungsproblemen. Hoffentlich kommt irgendwann eine Lösung für die Vermögensverwaltung und die erweiterte Kürzung. Ich lasse mich gerne freudig überraschen.
IZ: Herr Krauß, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Was in der EU-Richtlinie zur Gebäudeeffizienz steht
Bis 2050 soll der gesamte Gebäudebestand klimaneutral umgestellt sein. Von 2028 an müssen neue öffentliche Gebäude den Null-Emissionsstandard erfüllen. Für alle anderen Neubauten gilt die Anforderung ab 2030.

Die Vision einer zukünftigen, klimaneutralen Stadt. Quelle: Generiert mit Adobe Firefly, Urheberin: Yvonne Orschel
Entsprechend der Richtlinien sind Gebäude so zu planen, dass später ohne größere Umbauten Solaranlagen installiert werden können. Für neue Wohnhäuser, Gewerbe sowie öffentliche Gebäude fordert die Richtlinie, sie bis 2030 mit PV-Anlagen auszustatten. Sofern dies technisch und wirtschaftlich machbar ist.
Der Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden soll bis 2030 um mindestens 16% sinken, verglichen mit 2020. Bei den Nicht-Wohngebäuden sollen bis 2030 rund 16% der ineffizientesten Gebäude saniert sein.
Die EPBD-Richtlinie wurde im April 2024 verabschiedet. Die EU-Staaten haben zwei Jahre Zeit zur Umsetzung. In Deutschland wäre das GEG anzupassen.
Diesen Artikel teilen